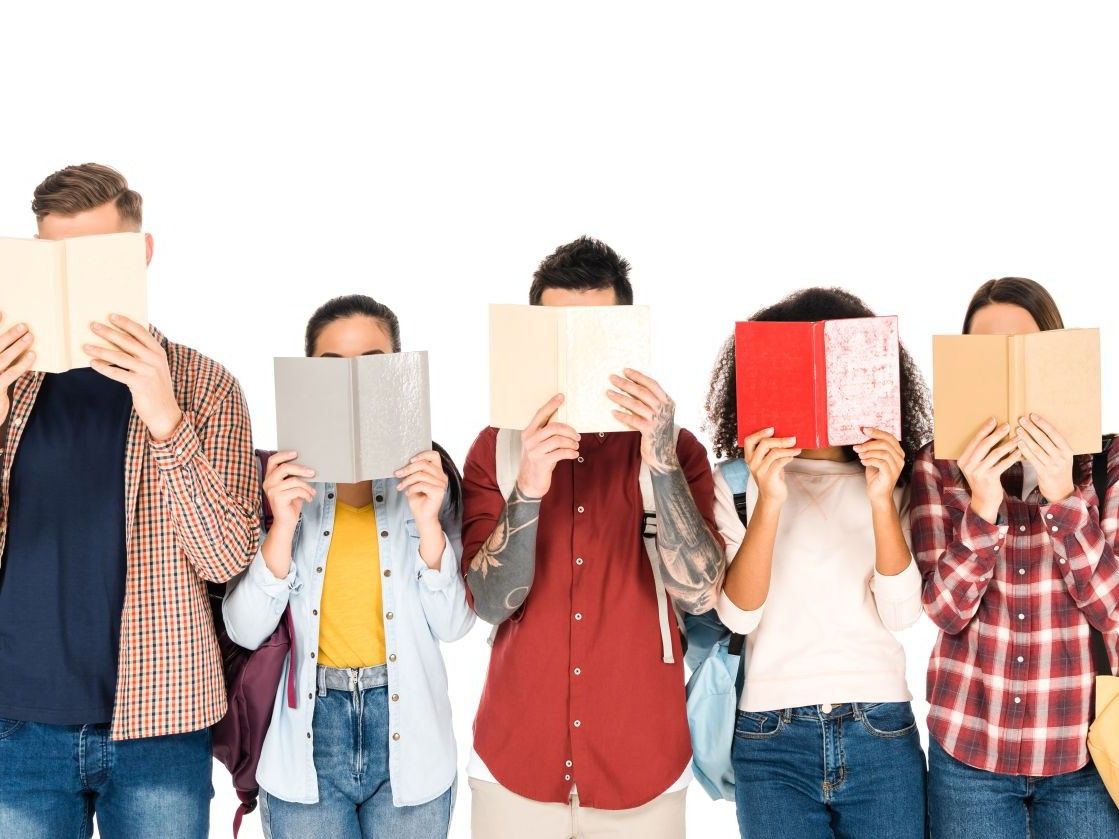Die neue Nationale Strategie für staatsbürgerliche Bildung(ENEC) wurde veröffentlicht und soll die vorherige aus dem Jahr 2017 ersetzen. Sie enthält auch einen Fahrplan für die wesentlichen Lerninhalte des Fachs, den es in der vorherigen Version nicht gab.
Mit dieser Maßnahme erfüllt die Regierung ein Wahlversprechen und reagiert auf die Kritik aus konservativeren Kreisen, dass das Fach Staatsbürgerkunde und Entwicklung zu sehr auf Themen fokussiert sei, die sie als Gender-Ideologie einstufen.
"Als Raum für die individuelle und kollektive Entwicklung sieht sich die Schule als privilegierter Ort für den Aufbau einer Kultur der aktiven, demokratischen und verantwortungsvollen Bürgerschaft, die von allen geteilt wird und den sozialen Zusammenhalt fördert", heißt es in dem ENEC-Text, der bis zum 1. August zur öffentlichen Konsultation steht. "Die portugiesische Gesellschaft steht in ihrem nationalen, europäischen und globalen Kontext vor zahllosen Herausforderungen, die Antworten erfordern, die auf ethischen Werten, Kenntnissen der bürgerlichen Regeln und demokratischen Institutionen, Empathie und sozialer Solidarität beruhen", heißt es in dem Dokument, und es wird betont, dass die Erziehung zur Bürgerschaft es jungen Menschen ermöglicht, Dialogfähigkeit, kritisches Denken und ein Bewusstsein für ihre Rolle zu entwickeln".
Bei den obligatorischen und bereichsübergreifenden Themen hebt der Vorschlag der Regierung die Menschenrechte, die Demokratie und die politischen Institutionen, die nachhaltige Entwicklung, die Finanzkompetenz und das Unternehmertum hervor.
Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf den Themen Gesundheit, Risiko und Verkehrssicherheit, Pluralismus und kulturelle Vielfalt sowie Medien.
"In einem globalen Kontext, in dem die Risiken der sozialen Fragmentierung, Fehlinformation und Polarisierung zunehmen, entspricht die Erziehung zur Staatsbürgerschaft einer Investition in den sozialen Zusammenhalt auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie Menschenrechte, Gleichheit und Nichtdiskriminierung, die das Fundament des portugiesischen demokratischen Rechtsstaates und freier Gesellschaften bilden", heißt es in der Mitteilung. Eine Analyse des Regierungsvorschlags und der aktuellen Strategie kommt zu dem Schluss, dass die Aufmerksamkeit für Sexualität oder sexuelle Orientierung nicht mehr vorhanden ist und nur im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen angesprochen wird.
Nur im grundlegenden Lernpfad für den dritten Zyklus und im Kapitel über Menschenrechte wird von den Schülern verlangt, dass sie "historische und aktuelle Fälle von Menschenrechtsverletzungen (einschließlich u. a. Menschenhandel, sexueller Missbrauch, geschlechtsspezifische Gewalt sowie Gewalt gegen Menschen mit nicht-normativer sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität und -ausdruck) analysieren".
Auch sieht das Programm nur in dieser Phase, zwischen der 7. und 9. Klasse, vor, "die (Un-)Gleichheit der Geschlechter in Kontexten wie Bildung, Arbeit und politischen Ämtern zu diskutieren".
Der Vorschlag der Regierung sieht vor, dass das Thema Tierquälerei, das im aktuellen Programm hervorgehoben wird, eines der Themen ist, die im Kapitel über nachhaltige Entwicklung für die Schüler des zweiten Zyklus behandelt werden, um sie dazu zu bringen, "über Situationen nachzudenken, in denen menschliches Handeln das Wohlergehen von Tieren gefährden kann". Die Interaktion mit anderen Kulturen bleibt ein wichtiger Punkt, wobei der aktuelle Vorschlag den Begriff "kulturelle Vielfalt" anstelle von "Interkulturalität" enthält, der im aktuellen Lehrplan enthalten ist.
In dem Vorschlag spricht sich die Regierung dafür aus, Grundschülern unter anderem beizubringen, "Offenheit und Neugierde zu zeigen, wenn es darum geht, etwas über andere zu lernen" und "an Initiativen teilzunehmen, die ihre eigene Kultur sowie andere Kulturen im Rahmen der verfassungsmäßigen Werte der portugiesischen Gesellschaft feiern und schätzen".
In der zweiten und dritten Klasse wird von den Schülern verlangt, dass sie die "kulturelle Vielfalt im schulischen Kontext" wertschätzen, "die Bedeutung des Schutzes der Rechte von Minderheiten und ihrer Kulturen" erörtern und die "Herausforderungen, die Migranten in der Aufnahmegesellschaft erleben", erkennen. Erst in der Oberstufe werden die Schüler aufgefordert, "kritisch über die kulturellen Folgen der gegenwärtigen Globalisierungsprozesse (Homogenisierung versus Differenzierung und Fragmentierung) nachzudenken", "verschiedene Formen der Diskriminierung wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antiziganismus, Islamophobie, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit zu analysieren" und "die Rolle des interkulturellen Dialogs und des Pluralismus für den Zusammenhalt kulturell vielfältiger Gesellschaften zu erörtern".
Eines der neuen Elemente des Programms ist die finanzielle Bildung und das Thema Unternehmertum. Jüngere Schüler sollen "die Bedeutung des Sparens und seine Ziele verstehen" und "zwischen der Aufnahme von Krediten (von Familie, Freunden oder Banken) und der Vergabe von Krediten unterscheiden".
Ältere Schüler werden ein persönliches und familiäres Budget sowie ein Budget für "ein unternehmerisches Projekt unter Berücksichtigung strategischer Partnerschaften und notwendiger Ressourcen" erstellen und "innovative Ideen validieren, die einen Mehrwert schaffen können".
Das Thema "Medien" steht ebenfalls im Mittelpunkt des öffentlich diskutierten Vorschlags, der darauf abzielt, "Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Informationen zu interpretieren und soziale Medien zu nutzen, insbesondere beim Zugang zu und bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, mit dem Ziel, angemessene Einstellungen und Verhaltensweisen für die kritische und sichere Nutzung digitaler Technologien, Informationen und von künstlicher Intelligenz erzeugter Inhalte zu übernehmen".
Ältere Erwachsene werden um Vorschläge gebeten, um "die Online-Umgebung und das Wohlbefinden in ihrer Beziehung zu digitalen Medien zu verändern und zu verbessern, um Online-Risiken (Sucht, Cybermobbing, Hassreden, Polarisierung, Trolling, Sexting, Sextortion usw.) zu verhindern."